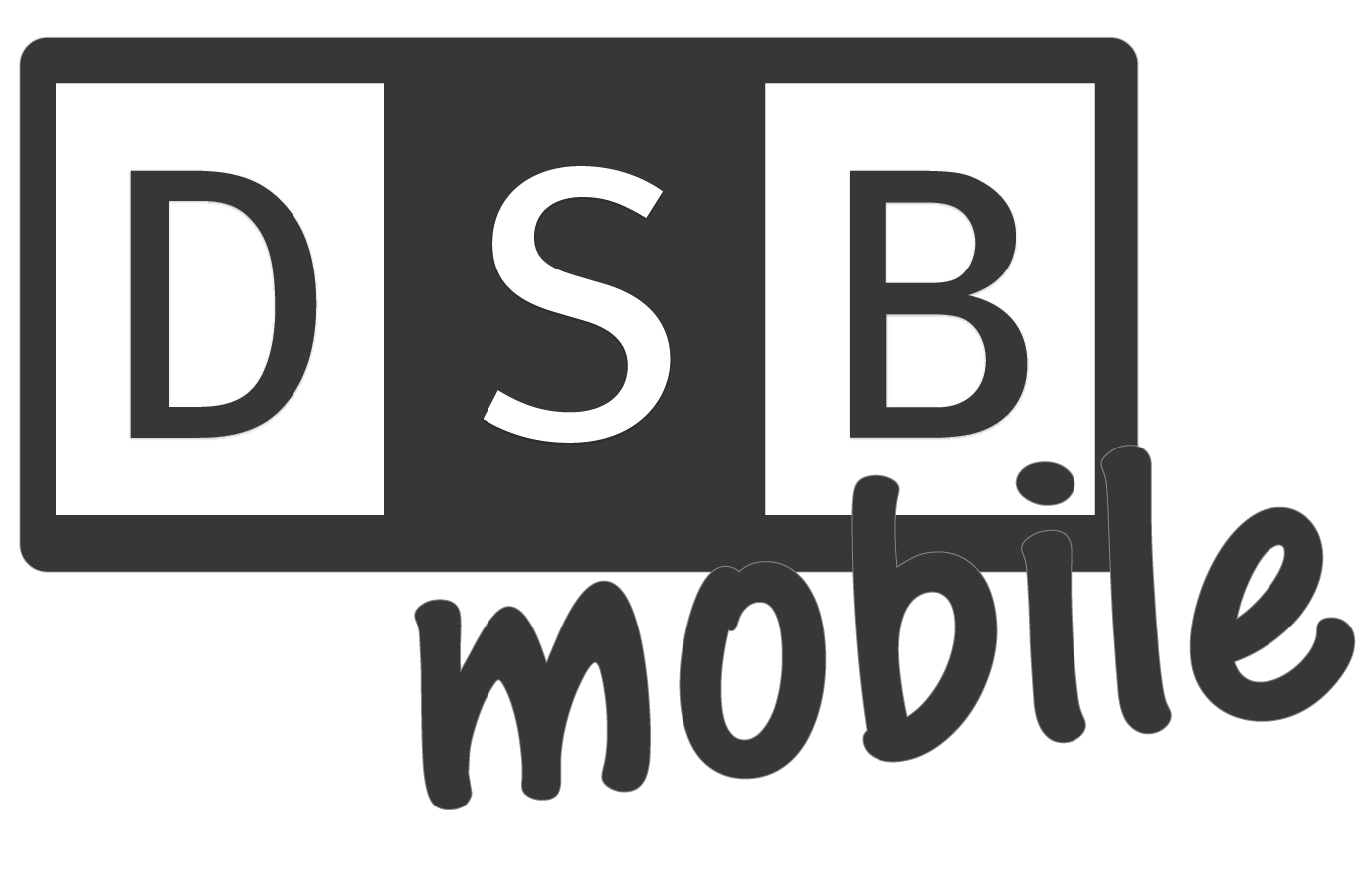Viele Blätter für ein besseres Miteinander
Wunschbaum für Toleranz in Potsdam
Voltaire-Schüler haben ihren Wunschbaum für Toleranz im Potsdamer Rathaus aufgestellt. Dort ist er bis zum Advent zu sehen – und weiter zu spicken. Rathausbesucher sind aufgerufen, zu Stift und Papier zu greifen und ihren Ideen für ein besseres Miteinander freien Lauf zu lassen. Die Stadt prüft nach dem Abbau die Wünsche auf ihre Umsetzbarkeit.
![]()
Von Martin Weigle
Potsdam. „Es ist ungewöhnlich für diese Jahreszeit, dass ein Baum noch so viele Blätter trägt“, sagt Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) als er im Foyer des Potsdamer Rathauses den Wunschbaum für Toleranz erblickt. Die bunten Zettel, die das Laub darstellen, sind mit Büroklammern an die Holzkonstruktion angeheftet. Auf jedem einzelnen ist ein Wunsch für ein besseres Miteinander in der Landeshauptstadt vermerkt.
Politische Bildung und Bummel im Baumarkt
Angefertigt haben den Baum Schüler der 13. Klasse der Voltaire-Gesamtschule. Sie haben die Idee im Rahmen des Kurses „Politische Bildung“ entwickelt. Lehrer Gordon Schwedt hat den Jugendlichen dabei völlig freie Hand gelassen. Sie sollten sich eigenständig an das Thema soziale Ungleichheit heranwagen. „Wir haben gemeinsam über verschiedene Ideen und Möglichkeiten diskutiert“, sagt Jonas Alhorn, einer der Schüler. Der Wunschbaum sei dann der Vorschlag gewesen, auf den sich alle 18 Kursteilnehmer einigen konnten. Anschließend haben sie die Materialien im Baumarkt besorgt und daraus ihren Baum gebastelt.
Beim 10. Fest für Toleranz im September – es stand unter dem Motto „Ankommen, Zusammenkommen, Willkommen in Potsdam“ – hat die Gruppe das Projekt zum ersten Mal vorgestellt und bei den Festbesuchern weitere Wünsche gesammelt. Der Baum war zu diesem Zeitpunkt noch relativ kahl, bekam aber an diesem Tag sein mächtiges Blattwerk. Zu viele Zettel hängen an den Ästen und Zweigen, als dass auf den ersten Blick einzelne Wünsche erkennbar wären. Erst bei näherem Hinsehen sind die Bitten nach mehr Respekt, nach Chancengleichheit und Bildung lesbar.
Für mehr Verständnis und bessere Kommunikation
Die Schüler selbst haben ähnliche Wünsche an den Baum gehängt. Natascha Wegat etwa sieht den Schlüssel zu mehr Toleranz in gegenseitiger Kommunikation: „Wir haben so viele technische Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren, warum werden diese nicht genutzt?“, fragt die Schülerin. Sehr wichtig ist der 18-Jährigen dabei, dass auch Vertreter der jüngeren Generationen häufiger gehört werden. Ihr ein Jahr älterer Mitschüler Till Nehls wünscht sich eine noch intensivere Zusammenarbeit mit Migranten, um das gegenseitige Verständnis zu verbessern.
Die verschiedenen Ansätze lassen Oberbürgermeister Jakobs und die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Birgit Müller (Linke), staunen. Es sei noch nicht abzusehen, inwieweit die Wünsche umgesetzt werden können, aber man werde sich damit auseinandersetzen, versichern die beiden. Der Baum werde jedenfalls bis zu seiner Ablösung durch einen Weihnachtsbaum im Rathaus-Foyer stehen leiben, versprach Jakobs. Solange werden dort auch Zettel und Stifte ausgelegt, so können sich Rathausbesucher an dem Projekt beteiligen und selbst Wünsche aufschreiben.
Die Wunschzettel werden nach dem Abbau thematisch sortiert und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Dazu sollen dann auch die Voltaireschüler wieder ins Rathaus kommen.
Link zum Presseartikel