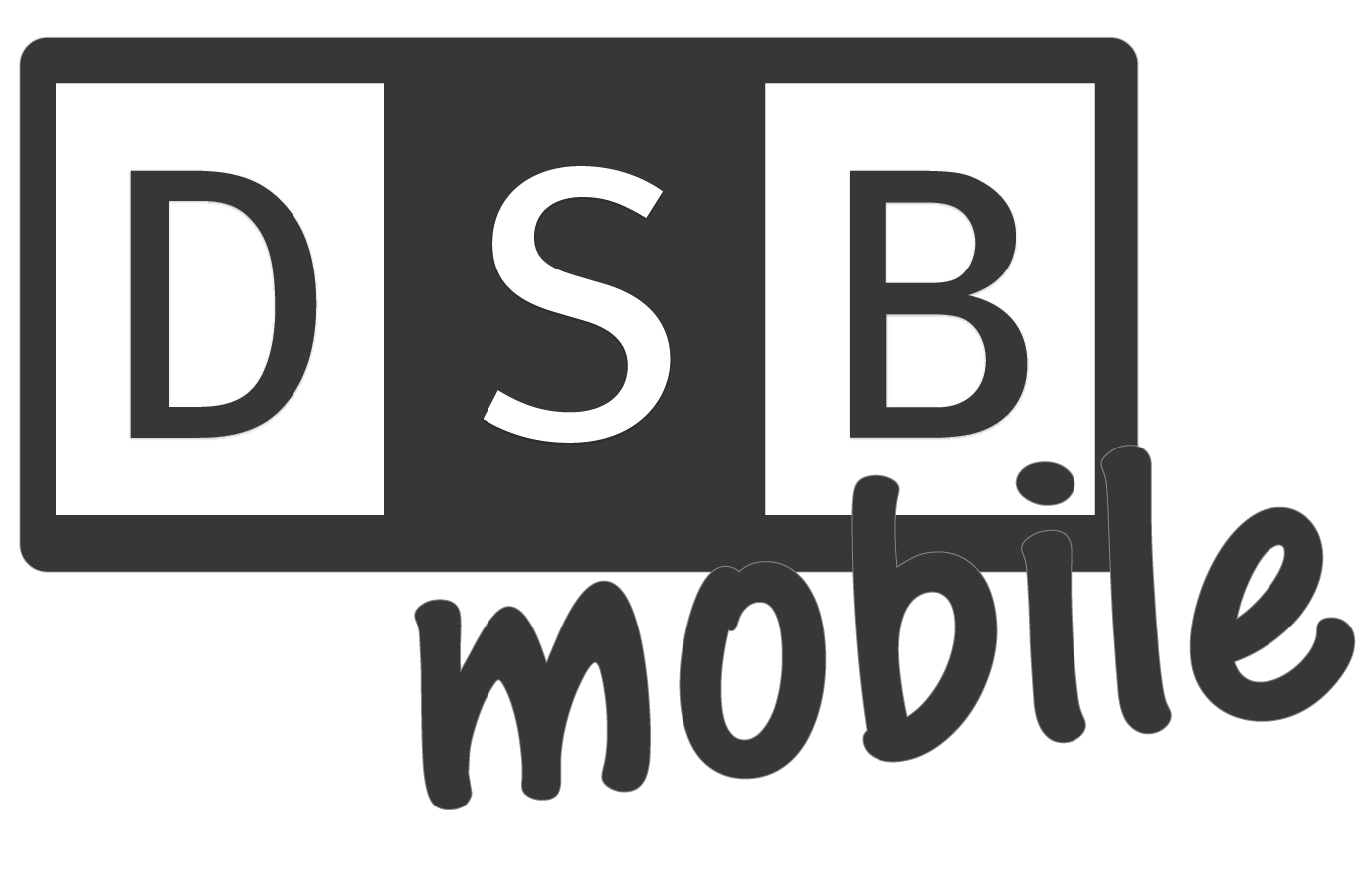Schulen in Potsdam werden digital aufgerüstet
KOMPLETT KREIDEFREI
Das Rathaus will eine Million Euro extra in die Computertechnik an Schulen investieren. Auch das Land hat Nachbesserungen angekündigt

 Die 16-jährigen Schülerinnen Emma (l.) und Katharina arbeiten an der Voltaire-Schule in Potsdam gemeinsam an Computer und Tablet. Foto: B. Settnik/dpa
Die 16-jährigen Schülerinnen Emma (l.) und Katharina arbeiten an der Voltaire-Schule in Potsdam gemeinsam an Computer und Tablet. Foto: B. Settnik/dpa
Von Henri Kramer
Potsdam - Ungenügende Wartung, veraltete Technik: Die Stadt Potsdam stellt sich personell und finanziell neu auf, um Probleme bei der Digitalisierung an Schulen zu lösen. So sei für die Informationstechnik an den Lehreinrichtungen nicht mehr das Bildungsdezernat im Rathaus, sondern ab sofort der Fachbereich für Innovation zuständig, bestätigte dessen Leiter Christoph Andersen am Montag den PNN. Die Stadt plane zudem für den aktuellen Doppelhaushalt 2018/2019 zusätzlich eine Million Euro für die IT-Modernisierung an den Schulen ein, hieß es weiter.
Anderson sagte, Ziel der Umstrukturierung sei ein „einheitlicher IT-Dienstleister“ für die Schulen. Die seit Herbst begonnene Vereinheitlichung der digitalen Infrastruktur an den Schulen werde „uns auf Jahre beschäftigen“, betonte Anderson und machte so den Nachholbedarf deutlich. Eine erste konkrete Maßnahme sei, dass die Schulrechner nun auch mit der Fernwartungssoftware ausgerüstet seien, die im Rathaus bei technischen Schwierigkeiten zum Einsatz könne. „Damit können wir bei Fragen zu Alltagsproblemen deutlich schneller als bisher antworten.“ Auch die Zahl der Mitarbeiter, die für die Wartung der Computer an den rund 45 Schulen der Stadt zuständig sind, sei von drei auf vier erhöht worden. „Weitere Verbesserungen sind im Gespräch“, so Anderson.
18 weitere Schulen sollen noch in diesem Jahr neue Rechner erhalten
Zudem macht sich die Stadt an die ins Stocken geratene Umsetzung des bereits 2014 beschlossenen IT-Masterplans für die Schulen. 2015 sei bereits die Technik an neun Schulen erneuert worden, sagte Anderson. Mit der zusätzlichen Million für Computertechnik sollten noch in diesem Jahr 18 weitere Schulen neue Rechner erhalten. Danach werde die neue Technik für die noch verbleibenden Schulen ausgeschrieben, machte Andersen deutlich.
Ein weiteres Beispiel für noch bestehende Digitalisierungsprobleme ist die Tatsache, dass manche Schulen noch über privat von Lehrern oder Direktoren angelegte E-Mail-Postfächer kontaktiert werden müssen. „Das war auch an unserer Schule lange Zeit der Fall“, bestätigte etwa die Leiterin des Helmholtz-Gymnasiums, Grit Steinbuch, den PNN. Inzwischen hätten die Kollegen aber die Möglichkeit, auch eine offizielle Schuladresse zu nutzen. Zudem wolle man auch eine offizielle Kontaktadresse beantragen – derzeit nutzt die Schule ein T-Online-Postfach.
Kreidefreie Tafeln für Potsdamer Schüler
Solche Änderungen fordern Fachpolitiker für alle Schulen. „Es wäre wünschenswert, wenn alle Schulen mit einer klaren Lösung agieren könnten“, sagte der Vorsitzende des Bildungsausschusses, Clemens Viehrig (CDU/ANW). Und der Linke-Bildungsexperte Stefan Wollenberg sagte auf Anfrage, schon die Außenwirkung solcher Privat-Mailadressen sei nicht besonders professionell – zumal solche Lösungen im Sinne personenunabhängiger Zugriffsmöglichkeit schwierig und auch datenschutzrechtlich bedenklich seien.
Allerdings sei in diesem Fall das Land und nicht die Stadt zuständig, so Anderson. Ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte, für dieses landesweite Thema befinde man sich in Arbeitsgesprächen mit dem brandenburgischen IT-Dienstleister (ZIT-BB): „Wir arbeiten an einer Lösung.“ Das Rathaus teilte ferner mit, schon drei Schulen – die Grundschule im Bornstedter Feld, die Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule und die Gesamtschule Am Schilfhof – seien komplett mit kreidefreien und zum Teil interaktiven Tafeln ausgestattet. Über einen Breitbandanschluss mit mindestens 50 Megabyte pro Sekunde verfügten bereits 60 Prozent der Potsdamer Schulen.
Link zum Presseartikel